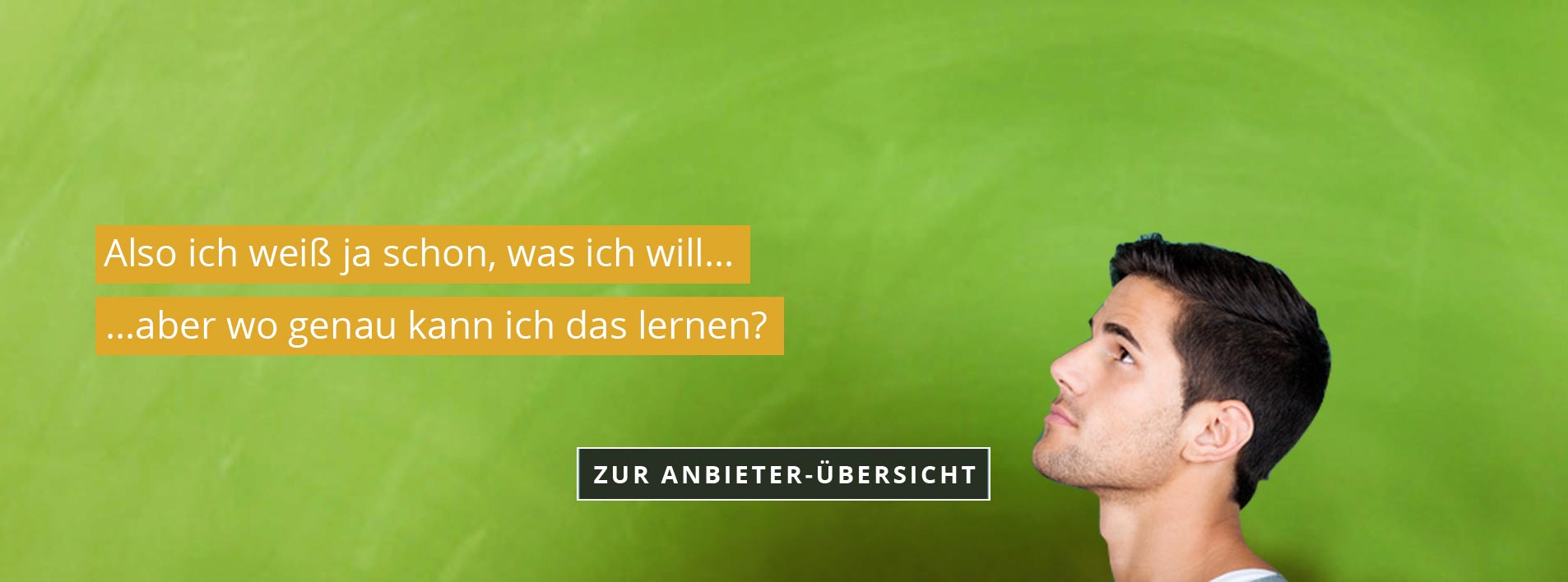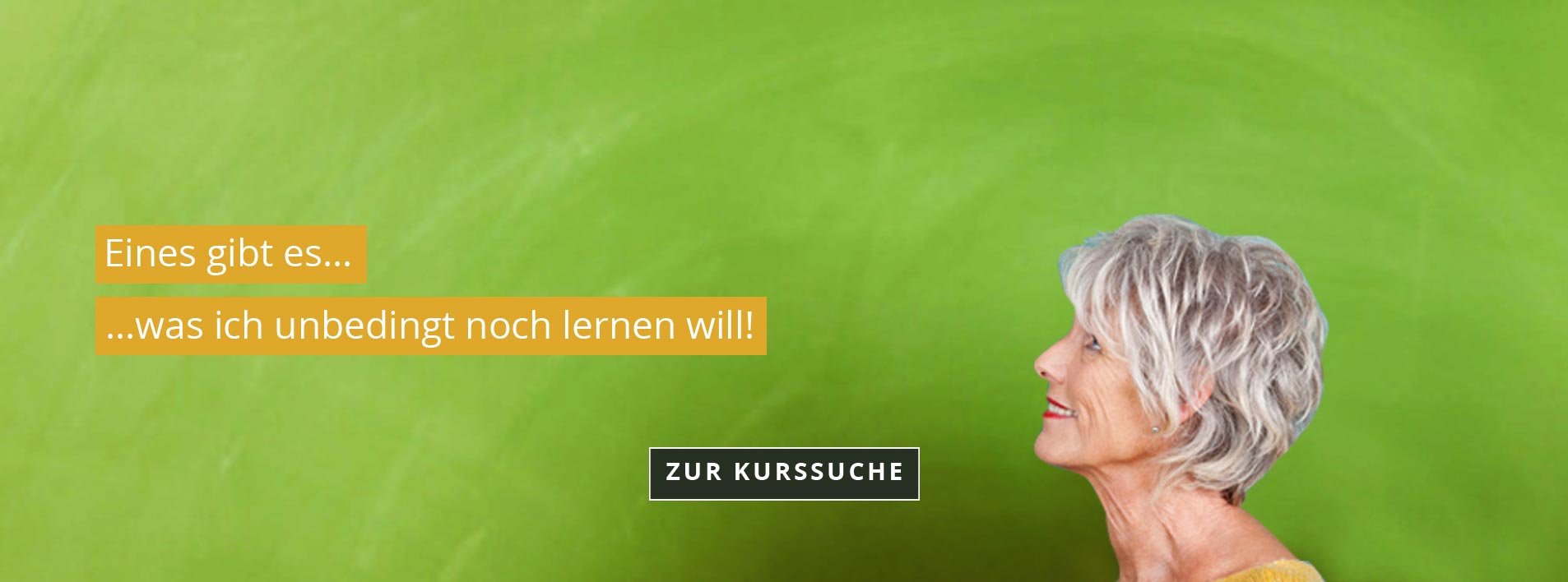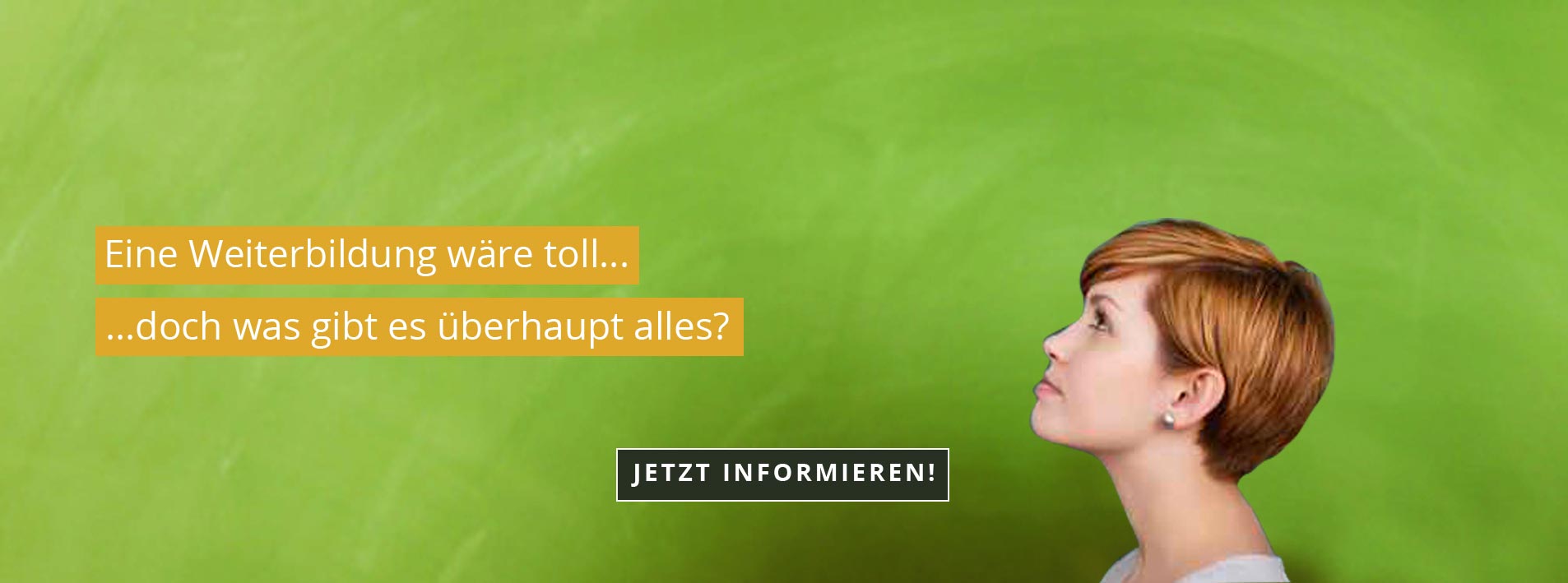Frauen sind in der Wissenschaft untervertren
Nur 18 Prozent der Hochschulen werden von Frauen geführt. Der Frauenanteil in der öffentlichen und privaten Forschung liegt meist unter dem europäischen Durchschnitt. Gemäss den Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS), die im Bericht der Europäischen Kommission «She Figures 2015» zu Frauen in der Wissenschaft veröffentlicht wurden, verbessert sich diese Situation jedoch langsam.
Nur 18 Prozent der Hochschulen werden von Frauen geführt. Der Frauenanteil in der öffentlichen und privaten Forschung liegt meist unter dem europäischen Durchschnitt. Gemäss den Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS), die im Bericht der Europäischen Kommission «She Figures 2015» zu Frauen in der Wissenschaft veröffentlicht wurden, verbessert sich diese Situation jedoch langsam.
Eine akademische Laufbahn beginnt mit dem Erwerb eines Doktortitels. Mit einem Frauenanteil von 43 Prozent der Promovierten im Jahr 2012 lag die Schweiz europaweit auf dem letzten Rang (europäischer Durchschnitt – EU28: 47%). Es sind auf dieser Stufe jedoch Fortschritte bei der Gleichstellung von Mann und Frau zu beobachten: Im Jahr 2004 betrug der Anteil der Frauen lediglich 37 Prozent. Je nach Fachbereich bestehen allerdings grosse Unterschiede. Männer und Frauen konzentrieren sich jeweils auf ganz spezifische Fachrichtungen. 2012 entfielen im Ingenieurwesen 24 Prozent der Doktortitel auf Frauen, im Bildungsbereich waren es hingegen 57 Prozent.
Kaum Frauen in akademischen Laufbahnen
Wie überall in Europa nimmt der Frauenanteil auch in der Schweiz ab, je höher man die Stufen der akademischen Karriereleiter hinaufsteigt. 2013 lag der Frauenanteil im unteren akademischen Mittelbau (wissenschaftliche Mitarbeitende) bei 38 Prozent (EU28: 45%). Bei den leitenden Forschenden, dem höchsten akademischen Grad, betrug er 19 Prozent (EU28: 21%).
Mehrheitlich Männer an der Spitze wissenschaftlicher Institutionen
Eine wissenschaftliche Laufbahn kann mit der Wahl an die Spitze einer Hochschule (Rektor/in oder Präsident/in) oder in den Hochschulrat fortgesetzt werden. Im Jahr 2014 wurden 18 Prozent der Hochschulen von Frauen geleitet (EU28: 20%). Sie stellten 23 Prozent der Hochschulratsmitglieder (EU28: 41%).
Vielversprechende Zuwachsraten
Verglichen mit den früheren Publikationen von «She Figures» zeigen die im Bericht 2015 veröffentlichten Prozentzahlen eine gewisse Zunahme des Frauenanteils in der Wissenschaft. In der Schweiz zum Beispiel betrug die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate zwischen 2002 und 2012 bei den Frauen mit neu erworbenem Doktortitel 5 Prozent und bei den Männern mit neu erworbenem Doktortitel 1 Prozent (EU: 4% bzw. 2%). Trotz dieser sehr vielversprechenden Zahlen wird es aber noch einige Zeit dauern, bis in diesem Bereich ein Geschlechtergleichgewicht erreicht wird.